– eine Replik zur Rezension von Smid, DZWIR 2011, S. 446 ff.
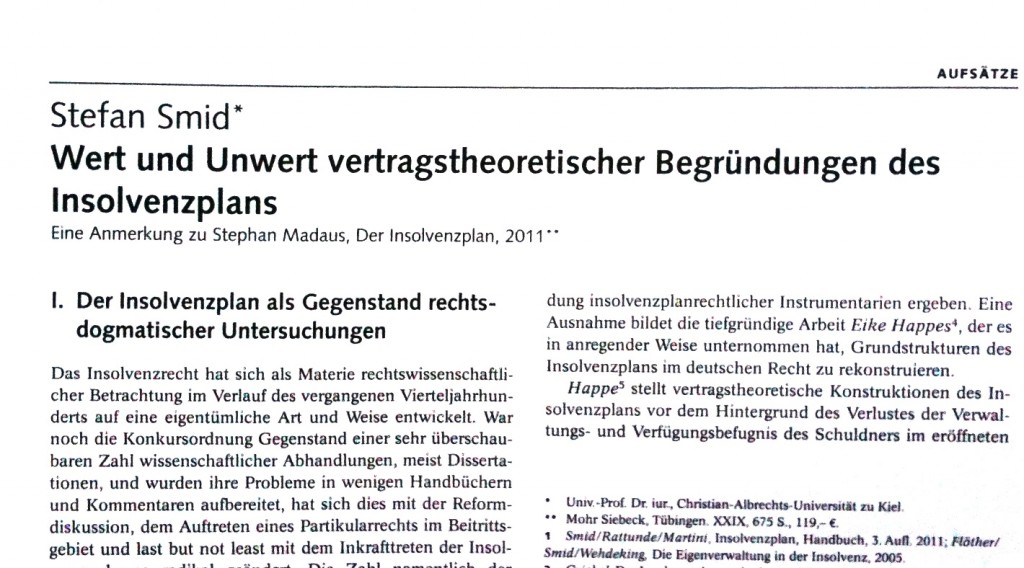 Prof. Stefan Smid hat sich in seiner Anmerkung ausführlich mit meinem Vorschlag auseinandergesetzt, den Insolvenzplan als Vertrag, genauer als Vergleich im Sinne des § 779 BGB anzusehen. Dieser (Haupt-)Teil seiner Anmerkung ist überaus kritisch ausgefallen und ich möchte an dieser Stelle zumindest seinen Haupteinwänden entgegnen.
Prof. Stefan Smid hat sich in seiner Anmerkung ausführlich mit meinem Vorschlag auseinandergesetzt, den Insolvenzplan als Vertrag, genauer als Vergleich im Sinne des § 779 BGB anzusehen. Dieser (Haupt-)Teil seiner Anmerkung ist überaus kritisch ausgefallen und ich möchte an dieser Stelle zumindest seinen Haupteinwänden entgegnen.
Der Insolvenzplan als Sanierungsinstrument
Im ersten Teil des ersten Kapitels meiner Arbeit wird herausgestellt, dass der Insolvenzplan in seiner wirtschaftlichen Funktion primär ein Sanierungsinstrument ist und als solches auch vom Gesetzgeber geschaffen wurde. Dies schließt natürlich seine Verwendung als Liquidationsplan nicht aus; dennoch kann sich die einführende Darstellung an der Kernfunktion orientieren, wobei mehrfach deutlich gemacht wird, dass die Schwächen des Planverfahrens gegenüber einer übertragenden Sanierung auf der Zeitschiene liegen (hier hat sich durch das ESUG zwar eine Beschleunigung des Planverfahrens ergeben; Erfahrungen aus den USA zeigen aber, dass selbst bei effektiven Rahmenbedingungen Veräußerungen einfacher und schneller abzuwickeln sind als Planverfahren – dies verkennt Smid (S. 448) in seiner Kritik völlig). Zugleich wird keinesfalls „ausgeblendet“ (so Smid, S. 447), dass die Reorganisation des Unternehmensträgers Hauptanwendungsgebiet des Planverfahrens ist; ihre Sinnhaftigkeit aufgrund unübertragbarer Rechte ist oft sogar die entscheidende „questio facti“, was – entgegen Smids Anmerkung – deutlich aufgezeigt wird.
Der Insolvenzplan ist – aus rechtsdogmatischer Sicht – keine Rechtsnorm
Smid folgt der Grundidee von Happe (Die Rechtsnatur des Insolvenzplans, 2004 – auch wenn er dessen „normtheoretische Reflexionen“ für wenig überzeugend hält), der den Insolvenzplan als „konkrete, auf das Verfahren bezogene und für die Beteiligten geltende Norm bzw. als geltender Normkomplex“ begreift, weshalb er das Planverfahren als „formalisiertes Verfahren einer Art von Gesetzgebung“ auffasst (S. 447). Auch Smid erkennt in einem Insolvenzplan „Normqualitäten“ (S. 449) und stellt ihn in seinen Wirkungen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen gleich, die – da für eine Vielzahl von Anwendungsfällen entwickelt und auf Unterwerfung des Willens des Kunden gerichtet – heteronome wie auch generelle Wirkungen hätten. Diese Argumentation ist in beiden Punkten leider wenig tragfähig. Zum einen wirken AGB stets nur in dem einen jeweiligen Vertrag, in den sie einbezogen werden; ihre Wirkungsweise ist mithin nicht genereller Natur, sondern konkret-individueller. Allein der Umstand ihrer Vorformulierung kann ihnen keine Normqualität im Rechtssinn verschaffen. Zugleich ist gerade in dieser Hinsicht keine Vergleichbarkeit mit einem Insolvenzplan gegeben, ist dieser doch nie als Muster für eine Vielzahl von Anwendungsfällen vorformuliert vorhanden. Seine Generalität kann sich nie aus der beabsichtigten Mehrfachverwendung ergeben. Sie ergibt sich aber auch nicht aus dem einzelnen Anwendungsfall, da der Insolvenzplan stets nur einen einzelnen, abgegrenzten – also bestimmten – Personenkreis betrifft und bindet. Wenn dem Insolvenzplan aber jede Generalität fehlt und seine rechtsdogmatische Einordnung als Rechtsnorm (unstreitig!!) Generalität voraussetzt, so kann der Insolvenzplan keine Rechtsnorm sein. Allein die Zwangswirkung des Plans im Fall seiner nur mehrheitlichen Annahme gegenüber der Minderheit genügt eben nicht, um ihm Normqualität zu unterstellen.
Die kaum konstruierbare Einordnung als Rechtsnorm hätte zudem auch nicht den von Smid propagierten soziologischen Vorteil einer „Erwartungsstabilisierung“ (S. 449 nach Luhmann), wird diese doch für den betroffenen Personenkreis in mindestens gleichem Maße auch durch einen Vertrag geschaffen, denn natürlich wirkt ein Vertrag aufgrund seiner Anerkennung durch die Rechtsordnung für die Vertragsparteien wie eine privat gesetzte Rechtsnorm. Diese Wirkung zwingt aber keinesfalls zu der Annahme, der Insolvenzplan sei eine Rechtsnorm. Er ist ein Vertrag und wirkt als solcher quasi normsetzend für die Vertragsparteien.
Willenserklärungen und dogmatische Konstruktion
Zunächst ist erfreulicherweise festzuhalten, dass Smid meine Ansicht teilt, dass eine Planvorlage des Verwalters ebenso wenig ein Vertragsangebot enthalten kann wie eine des Schuldners (S. 449 f.; eine von mir „vernachlässigte“ BGH-Rechtsprechung existiert hierzu nicht, wohl aber ein Formulierungsfehler bei Smid: ich bin nie der Ansicht, die Schuldnervorlage sei ein Angebot – S. 449 – letzter Satz).
Hinsichtlich der Gläubigererklärungen mag Smid nicht der Trennung von Stimmabgabe und Willenserklärung folgen, da „von der Abgabe von Willenserklärungen in der InsO überhaupt nicht die Rede“ sei (S. 450). Dies ist nun alles andere als zutreffend, spricht doch die InsO mehrfach von der „Zustimmung der Gläubiger“ (§§ 245, 246, 248 InsO). Demgegenüber findet sich keine Spur eines Gesetzgebungsverfahrens im Text der InsO, die für die Annahme einer Rechtsnorm sprechen würde. Entscheidend ist aber, dass der Versuch einer dogmatischen Konstruktion gerade darin besteht, einer gesetzlichen Regelung ein System, eine dahinterstehende Ordnung, zu geben, die es ermöglicht, Regelungslücken unter Rückgriff auf diese Ordnung zu schließen. Der Gesetzeswortlaut muss hierzu keine Brücke schlagen; lediglich die Regelungswirkungen müssen mit dem dogmatischen Konzept im Einklang stehen bzw. die dogmatische Konzeption muss die gesetzliche Regelung in ihren Wirkungen erklären können. Hierzu ist es ohne weiteres denkbar, in den Abstimmungserklärungen der Beteiligten (Gläubiger, Gesellschafter, Schuldner) nicht nur Stimmabgaben, sondern auch Zustimmungserklärungen, also Willenserklärungen zu erkennen.
Die Planbestätigung ist keine Vertragsgenehmigung
In der Planbestätigung sieht Smid „zwanglos“ eine „Paraphierung von Normen durch die zuständigen Organe“ (S. 450). Dieser insofern eher beliebigen Interpretation setzte ich eine Interpretation entgegen, die die gerichtliche Tätigkeit nicht zu einer gesetzgeberischen werden lässt: Der Insolvenzrichter spricht Recht. Er entscheidet feststellend über die Vertragsentstehung (§ 250 InsO) und bei Mehrheitsentscheidungen zudem über das Bestehen einer gesetzlichen Zustimmungspflicht der Minderheit (§§ 245, 246 InsO). Diese Zustimmungspflicht wird dann in § 254 InsO wie in § 894 ZPO im Wege der Willenserklärungsfiktion durchgesetzt. Smid verkennt diesen Zusammenhang, wenn er meint, § 894 ZPO behandele „eine andere Fragestellung“ (S. 450). Die ausführlich kritisierten Ausführungen zur Natur des Insolvenz(plan)verfahrens machen in diesem Zusammenhang eben deutlich, dass das Insolvenzgericht im Verfahren teils rechtsprechend teils rechtsfürsorgend tätig wird und bei der Planbestätigung ein Akt der Rechtsprechung gegeben ist.
Die positive Aufnahme der Idee einer Bestätigungsinsolvenz
Erfreulich ist immerhin der Schluss der Anmerkung (S. 452 f.), in der Smid der Idee einer Bestätigungsinsolvenz abwartend interessiert gegenübersteht. Es bleibt in der Tat offen, wie die Praxis ein solches Instrument nutzen würde, wenn der Gesetzgeber das Experiment wagen würde.