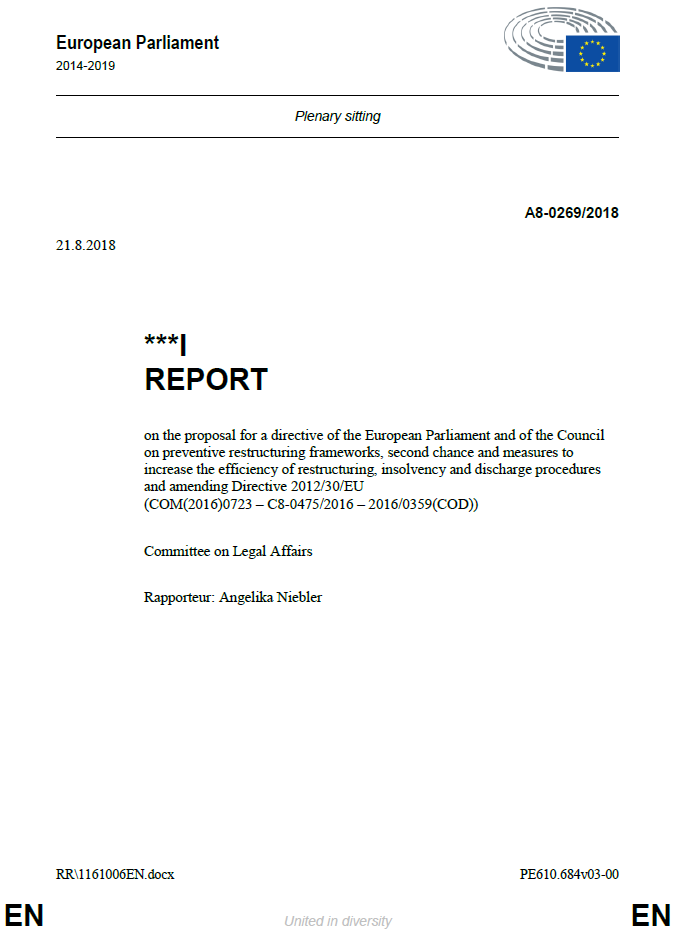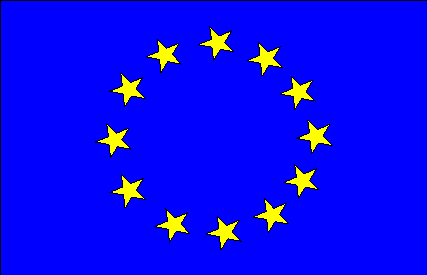Nach Abschluss der Beratungen in den Ratsarbeitsgruppen liegt nun auch die gemeinsame Ausrichtung des Rates zu dem Abschnitt des Richtlinienentwurfs vor, der den vorinsolvenzlichen Restrukturierungsrahmen betrifft (Link hier). Für die anderen Teile der Richtlinie (zur Restschuldbefreiung und zum institutionellen Rahmen) war schon zum Abschluss der Bulgarischen Ratspräsidentschaft eine gemeinsame Ausrichtung erreicht worden (Link hier).
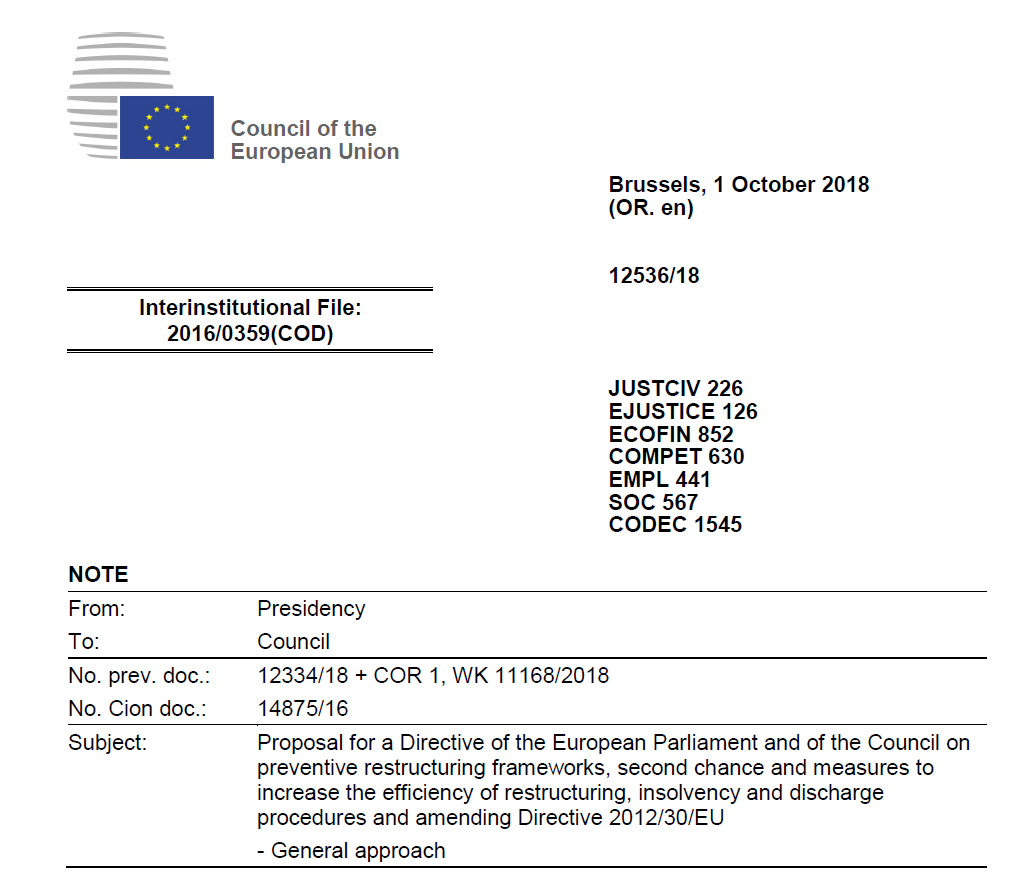 Im Gegensatz zum Parlamentsbericht hat die am Kommissionsvorschlag geäußerte Kritik in der gemeinsamen Ausrichtung des Rates zu einer weiteren Flexibilisierung der Richtlinienvorgaben geführt. Dabei gilt es besonders hervorzuheben, dass hier auch innovative Ideen aus der Wissenschaft Eingang in den Text gefunden haben, etwa indem bei Cross-class Cramdown neben der ‚Absolute Priority Rule‘ nun endlich auch die ‚Relative Priority Rule‘ als Regelungsoption vorgegeben wird. Diese war zuvor nicht nur im Bericht von Wessels und Madaus für das European Law Institute (Business Rescue in Insolvency) empfohlen worden; sie wurde vor allem im Rahmen des CODIRE-Projektes weiter präzisiert.
Im Gegensatz zum Parlamentsbericht hat die am Kommissionsvorschlag geäußerte Kritik in der gemeinsamen Ausrichtung des Rates zu einer weiteren Flexibilisierung der Richtlinienvorgaben geführt. Dabei gilt es besonders hervorzuheben, dass hier auch innovative Ideen aus der Wissenschaft Eingang in den Text gefunden haben, etwa indem bei Cross-class Cramdown neben der ‚Absolute Priority Rule‘ nun endlich auch die ‚Relative Priority Rule‘ als Regelungsoption vorgegeben wird. Diese war zuvor nicht nur im Bericht von Wessels und Madaus für das European Law Institute (Business Rescue in Insolvency) empfohlen worden; sie wurde vor allem im Rahmen des CODIRE-Projektes weiter präzisiert.
Daneben finden sich eine Reihe weiterer Kompromisse, die als Handlungsoptionen für den nationalen Gesetzgeber beschrieben werden, sodass nun eigenlich nur verbindlich vorgeben werden wird, dass es einen vorinsolvenzlichen Restrukturierungsrahmen mit bestimmten Instrumenten in allen Mitgliedsstaaten geben muss. Wie diese dann konkret zugänglich gemacht und ausgestaltet werden, bleibt nach der Vorstellung des Rates hingegen weitgehend den Mitgliedsstaaten überlassen. In der Umsetzung der Richtlinie wird also etwa zu entscheiden sein, ob
- ein Vollstreckungsstopp bzw. eine Planbestätigung eine gesonderte Feststellung der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens voraussetzt (viability test),
- damit stets auch die Bestellung eines Sachwalters zu verbinden ist,
- ob nur ein Vollstreckungsstopp gegen einzelne Beteiligte oder ein Moratorium mit kollektiver Wirkung zur Verfügung stehen soll,
- ob es eine Mindestdauer des Vollstreckungsstopps/Moratoriums geben soll,
- ob bei KMU die Vorgaben an die Gruppenbildung vereinfacht werden,
- ob ein Cross-class Cramdown schon bei nur einer tatsächlich zustimmenden Gruppe möglich sein soll, solange diese Gruppe aus gesicherten bzw. bevorzugt zu befriedigenden Gläubigern besteht,
- ob die Fairness eine Cross-class Cramdown anhand der Absolute oder der Relative Priority Rule zu bemessen ist.
Demgegenüber bleiben vor allem die Vorgaben zur Dauer des Vollstreckungsstopps/Moratoriums strikt (maximal 4 Monate, verlängerbar auf maximal 12 Monate bzw. bis zum Ergehen der gerichtlichen Entscheidung über den Plan).
Können sich diese Positionen im weiteren Gesetzgebungsprozess gegenüber den Parlamentspositionen behaupten, so wird es den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht möglich sein, vorinsolvenzliche Restrukturierungshilfen flexibel an die vorhandenen Regelungssysteme anzupassen. In vielen Rechtsordnungen werden die bereits vorhandenen vorinsolvenzlichen Verfahren dazu wohl nur noch geringfügig angepasst werden müssen. In Deutschland wird hingegen ein Rechtsschöpfungsprozess beginnen müssen, der auf die Erkenntnisse der ESUG Evaluation aufbauen und die Schaffung eines passgenauen Restrukturierungsrechts mit vorinsolvenzlichen und insolvenzlichen Handlungsoptionen zum Ziel haben sollte. Auch hierzu haben Bob Wessels und ich schon Ideen vorgestellt. Im Ergebnis werden die flexiblen Richtlinienvorhaben damit nur einen sehr begrenzten Harmonisierungseffekt erzielen können. Der Wettbewerb der Restrukturierungsrechte im Binnenmarkt wird so befeuert werden.