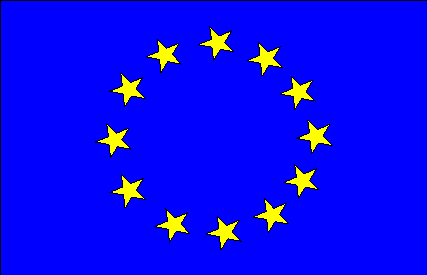Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz reagiert auf von der Politik geschaffene Sondersituation und die so sicher bevorstehende Rezession in einer Pressemitteilung vom 16.3.2020 sehr vorsichtig und nur durch die Wiederholung erprobter Maßnahmen. Wie schon in den Hochwasserkatastrophen 2002, 2013 und 2016 ist bislang nur eine gesetzliche Regelung zur bedingten Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis zum 30.09.2020 vorgesehen, die durch das BMJV durch Verordnung bis zum 31.03.2021 verlängert werden kann. Damals lautete die Regelung in § 1 des Gesetzes zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bei hochwasser- und starkregenfallbedingter Insolvenz wie folgt:
„Beruht der Eintritt einer Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung auf den Auswirkungen der Starkregenfälle und Hochwasser im Mai und Juni 2016, so ist die nach § 15a der Insolvenzordnung bestehende Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags ausgesetzt, solange die Antragspflichtigen ernsthafte Finanzierungs- oder Sanierungsverhandlungen führen und dadurch begründete Aussichten auf Sanierung bestehen, längstens jedoch bis zum Ablauf des 31. Dezember 2016.“
Nun scheint nach dem Wortlaut der Pressemitteilung angedacht, die Aussetzung der Antragspflichten davon abhängig zu machen, dass „der Insolvenzgrund auf den Auswirkungen der Corona-Epidemie beruht und dass aufgrund einer Beantragung öffentlicher Hilfen bzw. ernsthafter Finanzierungs- oder Sanierungsverhandlungen eines Antragspflichtigen begründete Aussichten auf Sanierung bestehen.“
Diese Bedingung wird der Sondersituation nicht gerecht (ebenso Prof. Dr. Georg Bitter). Anders als bei einem Hochwasser treffen die Maßnahmen, die derzeit mit Bezug auf die Virusverbreitung getroffen werden, unmittelbar – und vor allem mittelbar – alle Unternehmen in Deutschland. Stornierungen und Auftragsrückgänge sind dabei nicht immer nachweisbar auf die Epidemie zurückzuführen, etwa wenn Auftraggeber Bestellungen stornieren, um ihre Liquidität angesichts der krisebbedingten Unsicherheiten zu sichern. Die verlangte Kausalität zu den Auswirkungen der Epidemie ist insofern entweder stets zu bejahen oder aber einer ex-post Betrachtung in späteren Insolvenzen-/Haftungsprozessen zu unterwerfen, die ex ante in den nächsten Wochen dazu führen wird, dass vorsichtshalber doch lieber Insolvenzanträge gestellt werden. Die Regelung verliert so ihre Wirkung.
Einen Fehlanreiz setzt dann auch noch die zweiten Voraussetzung. Das Führen von Sanierungsverhandlungen oder die Beantragung öffentlicher Hilfen ist sicher ein Indiz für das Vorliegen von wirtschaftlichen Schwierigkeiten, nicht aber für begründete Aussichten auf eine Sanierung. Insoweit passen die geforderten Indizien nicht zum gewünschten Ziel. Vor allem aber begründet die zweite Voraussetzung faktisch einen Zwang zur Beantragung von Mitteln bzw. zur Aufnahme von Verhandlungen, um angesichts der derzeitigen Prognoseunsicherheiten eine Suspendierung der Antragspflichten rechtssicher zu erreichen. Auch Unternehmer, denen es eigentlich möglich wäre, ohne staatliche Hilfe oder Finanzierungsverhandlungen die Zeiten der Unsicherheit zu überstehen, werden so zu solchen Maßnahmen gezwungen. Dieser Anreiz sollte vermieden werden.
Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Die Überlegungen des BMJV gehen in die richtige Richtung, sollten aber entschiedener ausfallen als in vergangenen – vergleichsweise regionalen – Hochwasserkrisen. Ich habe hierzu Vorschläge gemacht. Eher in Richtung der Förderung von Finanzierungshilfen gehen die Anregungen von Prof. Dr. Georg Bitter, der insofern vor allem Bedarf für Korrekturen im Bereich des Anfechtungsrechts sieht (ähnlich sehen erste Überlegungen der TMA Deutschland aus). Die Niederlande hatten gute Erfahrungen mit einem gesetzlichen Moratorium in Kombination mit einem Hilfsfonds angesichts einer verheerenden Überschwemmung im Februar 1953. Entsprechende Regelungen sollten nun auch für Deutschland vorbereitet werden. So fordet nun auch der Gravenbrucher Kreis schnelle Liquiditätshilfen. Die Selektions- und Marktaustrittsfunktion des Insolvenzrechts kann dann wieder einsetzen, wenn die Sondersituation bewältigt ist.