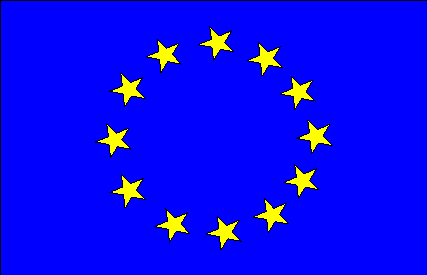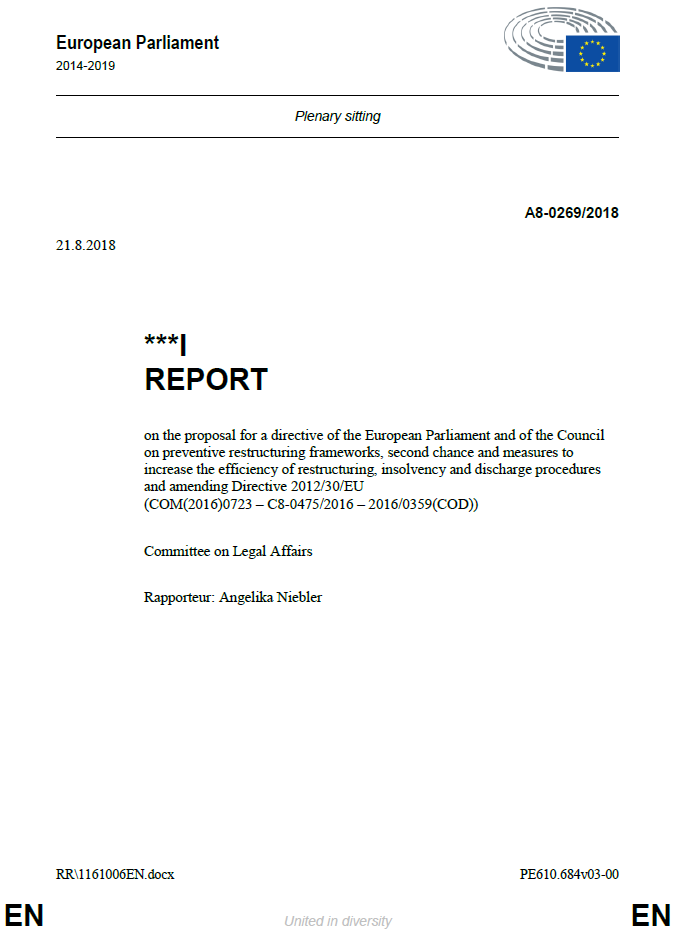Die Pandemie des Covid-19 wird vielleicht infolge der Krankheitsfälle, jedenfalls aber infolge der Gegenmaßnahmen und Marktreaktionen die Unternehmen in Schwierigkeiten bringen. Nicht nur „Zombie-Unternehmen“, Unternehmen mit grundsätzlich solidem Geschäftsmodell werden betroffen sein. Der exogene Schock trifft ganze Branchen (siehe die Umfrage des ifo-Instituts) und alle Unternehmensgrößen, vielleicht sogar alle Unternehmen. Während größere Unternehmen mit Hilfe von Beratern und Verhandlungsmacht gegenüber der Politik und den Finanzämtern der Sondersituation begegnen und noch Kreditabsorbtionskapazität besitzen, um staatliche Liquiditätshilfen zu nutzen, sieht die Situation bei den zehntausenden kleinen Unternehmen deutlich pessimistischer aus. Die Umsatzrenditen sind hier in der Regel so gering, dass weitere Kreditlasten keine Option sind, um Liquidität zu ersetzen, die aufgrund der Umsatzrückgänge fehlt. Gleichzeitig ist auch für den sorgfältigen Kaufmann unklar, wann sich die Situation wieder normalisiert. Liquiditäts- und Fortführungsprognosen werden quasi unmöglich. Dies wiederum kann zu Unternehmensinsolvenzen führen, obwohl derzeit nicht die Abwicklung dieser Kapazitäten, sondern deren „temporäres Einfrieren“ sachgerecht erscheint. Hierauf muss der Gesetzgeber reagieren und entsprechende Möglichkeiten im Insolvenzrecht kurzfristig und vielleicht nur vorübergehend schaffen.
1. Die Antragspflicht bei Überschuldung aussetzen
Die Unmöglichkeit einer seriösen Liquiditätsplanung für die kommenden Monate macht derzeit jede Fortführungsprognose für die Unternehmensleitung zu einem Drahtseilakt. Vorsichtige Unternehmensleiter müssten oft im Interesse der Begrenzung einer persönlichen Haftung Insolvenzanträge stellen, wenn Umsätze wegbrechen oder Absatzmärkte schließen. Eine solche Marktbereinigung grundsätzlich solider Unternehmen soll mit den Insolvenzantragspflichten sicher nicht verfolgt oder gar beschleunigt werden. Insofern ist es angezeigt, die Antragspflicht aufgrund des Überschuldungstatbestands (§ 19 InsO) temporär auszusetzen – etwa bis zum 31.8.2020. Über eine Wiedereinsetzung kann dann der InsO-Gesetzgeber im Rahmen der ESUG-Reformgesetzgebung entscheiden, ist hier das Thema der Abschaffung der Überschuldung als Antragspflicht ohnehin einer der Streitpunkte.
2. Den „Winterschlaf“ für (kleine) Krisenunternehmen temporär zulassen
Die gerade erst aufziehende Covid-19-Krise schafft aber nicht nur Probleme für die Liquiditätsplanung. Auf die akuten Liquiditätsprobleme gerade kleiner Unternehmen mit geringen oder fehlenden Liquiditätsreserven und keiner Kapazität zur krisenbedingten Kreditaufnahme muss auch mit einer Anpassung der Insolvenzantragspflichten bei Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) reagiert werden. Müssen Restaurants, Theater, Bäder und Kinos auf behördliche Anordnung für unbestimmte Zeit schließen und fehlen Hotels, Reisebüros, Messen und Verkehrsunternehmen die gewohnten Kundenzahlen und damit verbundene Einnahmen über Wochen, so bleibt hier nach geltendem Recht oft nur die Schließung verbunden mit der kurzfristigen Stellung eines Insolvenzantrags. Das Insolvenzverfahren kann dann ohne Einnahmen aus der Betriebsfortführung auch keine Strukturen erhalten. Stattdessen sollte überlegt werden, in der Krisenzeit ein „Einfrieren des Unternehmens“ zu erreichen.
Hierzu muss zunächst der Unterhalt des Unternehmers, seiner Angestellten und die Strukturerhaltung durch entsprechende zweckgebundene staatliche Zuschüsse (analog dem Kurzarbeitergeld) gesichert werden.
Sodann ist die krisenbedingte Zahlungsunfähigkeit zu adressieren, wozu verschiedene Ansätze denkbar sind:
Alternative 1: Suspendierung der Insolvenzantragspflichten/der Fälligkeit
Die einfachste gesetzgeberische Krisenreaktion könnte darin bestehen, die Antragspflichten aus § 15a InsO insgesamt vorübergehend (etwa bis zum 31.8.2020) zu suspendieren. Damit wäre dem Unternehmer der Handlungsdruck genommen, wenn zugleich auch die Insolvenzverschleppung für diesen Zeitraum zugelassen wäre, also keine Haftung (etwa aus § 64 GmbHG) droht, wenn man der Pflicht nicht entspricht.
Alternativ (und vorzugswürdig) wäre es auch denkbar, für eine gesetzlich bestimmten Krisenzeitraum die Fälligkeit von Zahlungspflichten auszusetzen, sodass Rechnungen, aber auch Steuerverbindlichkeiten etc., die in diesem Zeitraum fällig werden, nicht durchsetzbar sind und folglich für § 17 InsO (und alle hieran anknüpfenden Regeln) keine Rolle spielen. Diese Erleichterung sollte nicht erst in einem Verfahren erreicht werden müssen, sondern für den Krisenzeitraum gesetzlich angeordnet werden, auch wenn so alle Unternehmen begünstigt werden – unabhängig von ihrer Größe und Liquiditätslage. Sie könnte so gerade auch für den Fall Effekte erzielen, in dem Gerichte wegen Quarantänemaßnahmen nicht besetzt bzw. verfügbar sein sollten. (Dies etwa durch Notbesetzungen – ggf. auf OLG-Ebene – zu vermeiden, ist Sache der Justizverwaltungen der Länder! Auch die Möglichkeit telefonischer Erreichbarkeit oder Skype-/Zoom-Verhandlungen sollte nachgedacht werden – siehe England.)
Alternative 2: „Winterschlaf im Eröffnungsverfahren“
Will der Gesetzgeber die weitreichenden Maßnahmen der Alternative 1 vermeiden, so könnte zumindest auf die dann oft unvermeidliche Insolvenzantragstellung mit einem Ruhen des Eröffnungsverfahrens für den Krisenzeitraum reagieren. In dieser Alternative scheinen folgende Instrumente denkbar:
- Stellung des pflichtgemäßen Insolvenzantrags verbunden mit dem Antrag auf Ruhen des Verfahrens für die Krisenzeit (zB bis 31.8.2020) oder für eine bestimmte Zeit (etwa für 3 Monate),
- Stundung aller Forderungen und Suspendierung aller Vollstreckungen für die Dauer des Ruhens, inklusive Steuer- und Sozialversicherungsverbindlichkeiten, sowie Aufhebung aller Steuervorauszahlungen in diesem Zeitraum,
- Verbot aller Zahlungen auf Verbindlichkeiten mit Ausnahme derjenigen, die für den Erhalt der Strukturen erforderlich sind (Notbesetzung; Server usw.),
- Ruhen aller Pflichten und Befugnisse von Amtsträgern in diesem Zeitraum (inkl. vorläufige Sachwalter und Insolvenzverwalter), sodass keine Kosten entstehen,
- Fortsetzung des Verfahrens erst nach Ablauf der Frist, zuvor nur auf Antrag des Schuldners;
- Möglichkeit der Rücknahme des Insolvenzantrags im fortgesetzten Verfahren.
Diese insolvenzrechtliche Antwort auf die Covid-19-Herausforderung hat natürlich den Nachteil, das „I-Wort“ zu beinhalten. Dies kann die Bereitschaft zur entsprechenden Antragstellung im Kreis der Betroffenen erheblich mindern. Andererseits verhindert diese Gestaltung einen Missbrauch des Verfahrens und schafft eine Aufsicht und Verantwortlichkeit bei der Verfahrensaufhebung. Der Unternehmer ist so auch in der Ruhephase gehalten, an einer Lösung zu arbeiten. Zudem wäre es auch denkbar, diese Lösung zwingend als Eigenverwaltungslösung auszugestalten und an § 270b InsO anzuknüpfen, sodass der Marketingeffekt des „Schutzschirmverfahrens“ und der „Eigenverwaltung“ genutzt werden könnte.
Alternativ könnte auch eine Regelung der Instrumente in einem neuen § 240a ZPO – und damit insolvenzferner – erfolgen. Eine solche „modularisierte Lösung“ ließe sich durch den Gesetzgeber im Krisenfall „zuschalten“ und danach wieder „abschalten“.
Europäische Regelungen dürften keiner der vorgeschlagenen Krisenreaktionen im Wege stehen. Die EU-Kommission hat schon signalisiert, dass sie Beihilferegelungen nicht anwenden will. Entsprechendes dürfte für Auswirken im Bereich der Mehrwertsteuersystemrichtlinie und den bankaufsichtsrechtlichen Folgen (CRD IV) gelten. Das Zuwarten auf eine europäische Lösung ist nicht erforderlich.
3. Die vorzeitige Umsetzung der Restrukturierungsrichtlinie
Schließlich wird bereits vorgeschlagen, die Instrumente des präventiven Restrukturierungsrahmens zeitnah zur Verfügung zu stellen. Insbesondere die Möglichkeit zur Aussetzung von Zahlungspflichten (Art. 6, 7 der Richtlinie) könnte insofern vergleichbare Wirkungen erzeugen wie die oben angeregte gesetzliche Suspendierung von Fälligkeiten, zumal dies mit einer Suspendierung der Antragspflichten (inklusive derjenigen bei Zahlungsunfähigkeit) einhergeht. Diese Wirkungen sollten in einem Restrukturierungsrahmen allerdings nur auf Antrag, nur gegenüber einzelnen Vertragspartnern und erst nach gerichtliche Anordnung zur Verfügung stehen (siehe Blogpost zur Umsetzung). Dies kann natürlich genügen, um einzelnen Unternehmen zu helfen, die mit den Folgen der Covid-19-Krise kämpfen. Für die breite Masse gerade der kleinen Unternehmen wird hingegen eine einfachere, weil direktere Krisenhilfe notwendig sein.